Fleisch essen?
Fleisch ist wohl eines der umstrittensten Nahrungsmittel. Viele lehnen aus ethischen Gründen dessen Verzehr ab. Auch
haben zahlreiche bekannt gewordene Verstöße gegen das Lebensmittelrecht dazu geführt, wo immer uns Wurst und Fleischwaren begegnen, mindestens eine gewisse Skepsis an den Tag zu legen. Ist
das vielleicht Gammelfleisch? Sind in der Wurst Schlachtabfälle drin? Wurde dem Braten durch Aufspritzen mit Wasser mehr Gewicht verpasst? Waren die Steaks schon mal in einer anderen
Verpackung und wurden sie etwa umgepackt? Wer sich solche Fragen stellt, kann
schnell den Appetit verlieren. Insbesondere extrem niedrige Preise sollten tatsächlich skeptisch machen. Irgendwo ist
da in jedem Fall der Haken. Schlechte Qualität ist nämlich nicht zu- letzt auch schlecht bekömmlich.
Hochwertiges Fleisch hat seinen Preis. Die Quelle ist dann nachvollziehbar und verlässlich. Auch der einfache Blick
kann schon verraten: Ist es saftig-glänzend oder schmierig? Weiches Fleisch weist auf schlechte Qualität hin. Schweinefleisch sollte gleichmäßig rosa, Rindfleisch dunkelrot, Lammfleisch
hellrot bis rot und Wild auf keinen Fall bräunlich aussehen.
Fleisch von guter Qualität ist ein wertvolles Lebensmittel, das viele essentielle Nährstoffe liefert und in einer
ausgewogenen Ernährung bei den meisten Menschen gut platziert ist. Evolutionsbiologisch betrachtet, haben sich unsere Vorfahren vom reinen Pflanzenfresser zum Tierverwerter entwickelt.
Anthropologen vermuten sogar, dass erst dadurch das Gehirn des Urzeitmenschen eine entsprechende Ausbildung erfuhr.
So steuert das in Fleisch reichlich enthaltene Vitamin B6 nachweislich die Gehirntätigkeit. Weitere enthaltene
B-Vitamine sind Zellwachstumsfördernd und regulieren die Speicherung der Nahrungsenergie. Enthaltenes Niacin stabilisiert das Nervensystem. Zudem kann das hochwertige Eiweiß in tierischen
Produkten unser Körper optimal verwerten, was bei pflanzlichen Ersatzstoffen nicht zwingend gegeben ist.
Wer, aus welchen Gründen auch immer, auf Fleisch verzichten will, muss fehlende Nährstoffe gezielt ausgleichen.
Hülsenfrüchte, Sojaprodukte, viel frisches Gemüse und Vollkornprodukte liefern dem Körper B-Vitamine und Eisen. Fleischfreie Ernährung ist schwieriger, was eine ausgewogene Kombination
verschiedener Nährstoffquellen notwendig macht. Einfach Fleisch weglassen geht nicht. Schweine- und Rindfleisch ist deutlich nährstoffreicher als das von Geflügel. Schweinefleisch enthält
besonders viele der Vitamine B1 und B6, Rindfleisch besonders viel Zink, Eisen und B12.
Muskelfleisch besteht durchschnittlich aus rund 22 Prozent Eiweiß. Es ist reich an lebensnotwendigen Aminosäuren.
Diesen Proteinen wird neben denen in Ei- und Milcheiweiß die höchste biologische Wertigkeit zugesprochen.
Das in Fleisch enthaltene hochkonzentrierte blutbildende Eisen lässt sich durch künstlichen Zusatz von Eisen in
Lebensmitteln nicht ersetzten.
Doch auch zu viel Fleischkonsum ist schädlich. Möglicherweise herzschädigendes Cholesterin und gesättigte
Fettsäuren, ebenso Purine, die den Harnsäurespiegel erhöhen und Gicht auslösen können, sind bei jeder Fleischmahlzeit dabei. Über Jahre hieß es rotes Fleisch würde Krebs und
Herz-Kreislauf-Erkrankungen begünstigen, Geflügel sei da die bessere Alternative. Neuere Studien stellen insgesamt jahrelang ausgegebene Ernährungsregeln infrage. Daher kann die einfache
Faustregel gelten, dass eine möglichst vielfältige, abwechslungsreiche, auch fleischhaltige Ernährung in Ordnung ist, bei der Übermaß vermieden und Qualität beachtet wird. Geschmack und
ethische Vertretbarkeit sind sicherlich wichtigere Kriterien als die Beachtung statistischer
Zahlen.
Timo Schadt
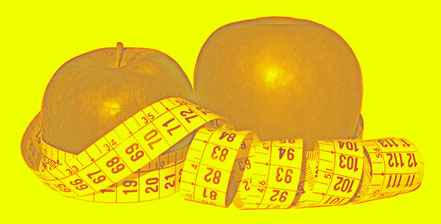
Dick dank Diät
Unaufhörlich konfrontieren die Medien mit vermeidlichen Siegern, aber auch Verlierern des Körperkults. Die einen
sind vor laufenden Kameras gedemütigte schwergewichtige Loser, die anderen zeigen stolz grinsend die einstig proppere Figur als mies gelaunten Pappkamerad. Mit Verdauungspräparaten und
selbstgeißelnder Enthaltsamkeit wollen sich deswegen nicht wenige den angefutterten Winterspeck vom Körper schaffen. Gegessen wird dann nicht mehr das, was schmeckt, sondern was
vermeintlich die Speckröllchen minimiert.
Das gesellschaftliche Bild, in dem einst ein Bauchansatz für Wohlstand stand, hat sich komplett umgekehrt. Hagere
sehnige Gestalten werden als Schönheiten verkauft. Dass diese ihr Erscheinungsbild häufigem Erbrechen und extensivem Zigarettenkonsum verdanken und nicht etwa Magerjogurt, Salat und
Vollkornprodukten, verschweigen die Medien. Abgemagerte Ernährungsberater/innen warnen stattdessen im Fernsehen vor den dramatischen Folgen von Übergewicht und verordnen den vom
Body-Mass-Index abweichenden Zuschauern die Nahrungsumstellung auf schlecht verdauliche Kost.
Beim Betrachten der vielen schönen, erfolgreichen Schlanken und hässlichen, meist dümmlich dargestellten Dicken
weiß jede/r von uns, zu welcher Gruppe er lieber gehören möchte. Also wird brav das gemacht, was vermeintlich Allgemeinbildung ist: Fett wird gemieden, Rohkost ersetzt Gebratenes,
Vollkornbratlinge das Steak…
Hunger ist nun ebenso ständiger Begleiter wie miese Gefühle über kleine Sünden, die sich trotzdem mal gegönnt
werden. Kummer kommt auf, vor allem über den mangelnden Ergebnisse auf der Waage. Auf ihr stehend, zeigt sich alltäglich der Fortschritt der Diät oder leider allzu oft eben auch nicht.
Versagensgefühle und Depressionen sind die Folge. Wo bleibt da noch Lebensfreude?
Der Lebensmittelchemiker Udo Pollmer, Leiter des Europäischen Instituts für Lebensmittel- und Ernährungsforschung
e.V. (EU.L.E.), hat in zahlreichen Publikationen und Interviews eine einfache Erklärung formuliert: „Diäten machen Dicke dicker, fördern Osteoporose und Gallensteine und verkürzen das
Leben.“ Wie er zu diesen Thesen kommt, sei nachfolgend dargelegt.
Menschen sind unterschiedlich, auch in ihrer Verdauung. Die Fähigkeit der Leber unerwünschte Stoffe abzubauen, ist
bei jeder Person anders. Die genetische Disposition ist hier sehr ausschlaggebend. Das führt dazu, dass bei manchen Menschen eine Neigung zum Fettspeichern gegeben ist, bei anderen die
Nährstoffverbrennung besser funktioniert. Letztere können fast alles essen, ohne dass der Körperansatz wächst. Die, bei welche die Veranlagung aufs „Speichern“ angelegt ist, können zwar
durch radikalen Verzicht das Volumen reduzieren. Sobald allerdings die Ernährung auch nur normalisiert wird, werden die Speicher erneut gefüllt, bis eben das „Normalmaß“ wieder erreicht
ist. Möglicherweise wird dann vom Körper sogar ein Zusatzvorrat angelegt, für nun, Dank Diät nun bekannte, schlechte Zeiten. Der Volksmund nennt dies Jojo-Effekt.
Unsere Ernährung ist geprägt von etlichen Irrtümern. Wer Diät-Margarine statt Butter kauft, tut einzig dem Handel
und der Lebensmittelindustrie etwas Gutes. Die lassen sich nämlich billige Pflanzenfette mit leeren Gesundheitsversprechen teuer bezahlen. Diät-Limonade enthält aus der Tiermast bekannte
Appetitanreger, die lediglich das Verlangen auslösen, endlich Nahrung zu bekommen. Zuviel Rohkost macht Magen- und Darmprobleme, da sie schlicht für den menschlichen Organismus nicht so
bekömmlich ist wie erhitzte und verarbeitete Lebensmittel. Fettverzicht ist nicht nur für den Geschmack von Nahrung ein Desaster, es hemmt die Verdauung.
Aufgrund von Selbstgeißelung Unterernährte sind logischerweise anfälliger für Krankheiten. Krankhaft Fettleibige, die wir tagtäglich von den Medien zur Abschreckung und Belustigung vorgeführt bekommen, haben sicherlich ein erhöhtes Krankheitsrisiko. Wer aber von der angeblich so wichtigen BMI-Norm um ein paar Kilo nach oben abweicht, muss weder aus zu viel Kalorienkonsum resultierenden Krankheiten, geschweige denn den frühen Tod fürchten. Statistisch sind diese Behauptungen, laut Udo Pollmer, längst widerlegt. Er ist davon überzeugt: Dicke leben länger und „Fettpolster sind im Alter Lebensreserven“.
Körperliche Anstrengungen haben in Jahrhunderten in unseren Breiten per natürlicher Selektion eine auf
Fettanlagerung ausgerichteten Menschentypus geschaffen, der mit den heute anstehenden „leichten Tätigkeiten“ schlicht unausgelastet ist. Wer sich daher regelmäßig, am besten in freier
Natur zusätzlich bewegt und auf eine vielfältige, abwechslungsreiche Ernährung einlässt, das isst, was ganz persönlich gut tut, handelt nicht nur vernünftig, sondern beugt Krankheiten vor
und fühlt sich dabei auch noch wohl. Abstinenzler hingegen sind nicht selten unglückliche und mies gelaunte Menschen. Standardisierte Lösungen sind bei individuellen körperlichen
Begebenheiten nicht anwendbar.
Eine kritische Betrachtung der Behandlung des Themas in den Massenmedien erleichtert vielmehr, als unsinnige Diäten
es je vermögen würden. Timo Schadt
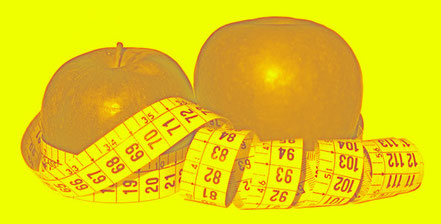
Dick dank Diät
Unaufhörlich konfrontieren die Medien mit vermeidlichen Siegern, aber auch Verlierern des Körperkults. Die einen
sind vor laufenden Kameras gedemütigte schwergewichtige Loser, die anderen zeigen stolz grinsend die einstig proppere Figur als mies gelaunten Pappkamerad. Mit Verdauungspräparaten und
selbstgeißelnder Enthaltsamkeit wollen sich deswegen nicht wenige den angefutterten Winterspeck vom Körper schaffen. Gegessen wird dann nicht mehr das, was schmeckt, sondern was
vermeintlich die Speckröllchen minimiert.
Das gesellschaftliche Bild, in dem einst ein Bauchansatz für Wohlstand stand, hat sich komplett umgekehrt. Hagere
sehnige Gestalten werden als Schönheiten verkauft. Dass diese ihr Erscheinungsbild häufigem Erbrechen und extensivem Zigarettenkonsum verdanken und nicht etwa Magerjogurt, Salat und
Vollkornprodukten, verschweigen die Medien. Abgemagerte Ernährungsberater/innen warnen stattdessen im Fernsehen vor den dramatischen Folgen von Übergewicht und verordnen den vom
Body-Mass-Index abweichenden Zuschauern die Nahrungsumstellung auf schlecht verdauliche Kost.
Beim Betrachten der vielen schönen, erfolgreichen Schlanken und hässlichen, meist dümmlich dargestellten Dicken
weiß jede/r von uns, zu welcher Gruppe er lieber gehören möchte. Also wird brav das gemacht, was vermeintlich Allgemeinbildung ist: Fett wird gemieden, Rohkost ersetzt Gebratenes,
Vollkornbratlinge das Steak…
Hunger ist nun ebenso ständiger Begleiter wie miese Gefühle über kleine Sünden, die sich trotzdem mal gegönnt
werden. Kummer kommt auf, vor allem über den mangelnden Ergebnisse auf der Waage. Auf ihr stehend, zeigt sich alltäglich der Fortschritt der Diät oder leider allzu oft eben auch nicht.
Versagensgefühle und Depressionen sind die Folge. Wo bleibt da noch Lebensfreude?
Der Lebensmittelchemiker Udo Pollmer, Leiter des Europäischen Instituts für Lebensmittel- und Ernährungsforschung
e.V. (EU.L.E.), hat in zahlreichen Publikationen und Interviews eine einfache Erklärung formuliert: „Diäten machen Dicke dicker, fördern Osteoporose und Gallensteine und verkürzen das
Leben.“ Wie er zu diesen Thesen kommt, sei nachfolgend dargelegt.
Menschen sind unterschiedlich, auch in ihrer Verdauung. Die Fähigkeit der Leber unerwünschte Stoffe abzubauen, ist
bei jeder Person anders. Die genetische Disposition ist hier sehr ausschlaggebend. Das führt dazu, dass bei manchen Menschen eine Neigung zum Fettspeichern gegeben ist, bei anderen die
Nährstoffverbrennung besser funktioniert. Letztere können fast alles essen, ohne dass der Körperansatz wächst. Die, bei welche die Veranlagung aufs „Speichern“ angelegt ist, können zwar
durch radikalen Verzicht das Volumen reduzieren. Sobald allerdings die Ernährung auch nur normalisiert wird, werden die Speicher erneut gefüllt, bis eben das „Normalmaß“ wieder erreicht
ist. Möglicherweise wird dann vom Körper sogar ein Zusatzvorrat angelegt, für nun, Dank Diät nun bekannte, schlechte Zeiten. Der Volksmund nennt dies Jojo-Effekt.
Unsere Ernährung ist geprägt von etlichen Irrtümern. Wer Diät-Margarine statt Butter kauft, tut einzig dem Handel
und der Lebensmittelindustrie etwas Gutes. Die lassen sich nämlich billige Pflanzenfette mit leeren Gesundheitsversprechen teuer bezahlen. Diät-Limonade enthält aus der Tiermast bekannte
Appetitanreger, die lediglich das Verlangen auslösen, endlich Nahrung zu bekommen. Zuviel Rohkost macht Magen- und Darmprobleme, da sie schlicht für den menschlichen Organismus nicht so
bekömmlich ist wie erhitzte und verarbeitete Lebensmittel. Fettverzicht ist nicht nur für den Geschmack von Nahrung ein Desaster, es hemmt die Verdauung.
Aufgrund von Selbstgeißelung Unterernährte sind logischerweise anfälliger für Krankheiten. Krankhaft Fettleibige, die wir tagtäglich von den Medien zur Abschreckung und Belustigung vorgeführt bekommen, haben sicherlich ein erhöhtes Krankheitsrisiko. Wer aber von der angeblich so wichtigen BMI-Norm um ein paar Kilo nach oben abweicht, muss weder aus zu viel Kalorienkonsum resultierenden Krankheiten, geschweige denn den frühen Tod fürchten. Statistisch sind diese Behauptungen, laut Udo Pollmer, längst widerlegt. Er ist davon überzeugt: Dicke leben länger und „Fettpolster sind im Alter Lebensreserven“.
Körperliche Anstrengungen haben in Jahrhunderten in unseren Breiten per natürlicher Selektion eine auf
Fettanlagerung ausgerichteten Menschentypus geschaffen, der mit den heute anstehenden „leichten Tätigkeiten“ schlicht unausgelastet ist. Wer sich daher regelmäßig, am besten in freier
Natur zusätzlich bewegt und auf eine vielfältige, abwechslungsreiche Ernährung einlässt, das isst, was ganz persönlich gut tut, handelt nicht nur vernünftig, sondern beugt Krankheiten vor
und fühlt sich dabei auch noch wohl. Abstinenzler hingegen sind nicht selten unglückliche und mies gelaunte Menschen. Standardisierte Lösungen sind bei individuellen körperlichen
Begebenheiten nicht anwendbar.
Eine kritische Betrachtung der Behandlung des Themas in den Massenmedien erleichtert vielmehr, als unsinnige Diäten
es je vermögen würden. Timo Schadt
Brennnessel-Samen
Die Blätter verfärben sich, es regnet, wird kälter und die Tage werden kürzer. Auch der menschliche Organismus kommt nicht mehr so richtig in Gang. Am besten ist es, jetzt rauszugehen und
jeden Sonnenstrahl mitzunehmen.
Weitestgehend ungenutzt steht da am Wegesrand oder Gartenzaun eine oft als Unkraut verschriene, aber sehr wertvolle Pflanze – die Brennnessel.
Nicht nur Schmetterlinge profitieren von ihr. Brennnesseln werden schon sehr lange auch als Heilpflanzen eingesetzt. Ob als Tee oder Salatbeigabe, frisch oder getrocknet, die
Einsatzmöglichkeiten sind vielfältig. Neben den frischen Blättern sind ebenfalls deren Samen hoch interessant. Sie enthalten nämlich Vitaminen A, B, C und E, zusätzlich noch Kalium, Kalzium,
Eisen, Chlorophylln und Carotinoide. Die Brennnessel-Samen sind genau das Richtige für trübe Herbsttage. Denn sie helfen gut gegen die ständige Müdigkeit und Antriebslosigkeit. Dabei wirken
sie blutreinigend, tonisierend sowie das Immunsystem stärkend und körperfunktionsbelebend. Das enthaltene Chlorophyll hilft im Nebeneffekt sogar gegen Mund- und Körpergeruch. In der Küche
können Brennnessel-Samen vielfältig zum Einsatz kommen.
Man sollte die Brennnessel-Samen vorsichtig von Pflanzen sammeln. Bekanntlich brennen deren Stengel und Blätter. Alle grünen Pflanzenteile sind nämlich mit Brenn- sowie Borstenhaaren besetzt.
Auch sollte nicht unbedingt an den Pflanzen gesammelt werden, die direkt in Straßennähe stehen. Folgend eine besonders schmackhafte saisonale Rezeptur für eine vierköpfige Familie:

Brennnessel-Samen-Reibekuchen
12 mittelgroße Kartoffeln schälen und reiben, ebenso eine Zwiebel und einen Apfel. Zwei Eier mit einem gestrichenen Esslöffel Salz, einem Esslöffel Mehl, einem halben Teelöffel Zucker sowie zwei
bis drei Esslöffel Brennnessel-Samen verrühren. Vier Esslöffel Haferflocken dazugegeben. Die geriebenen Zutaten nun einfach unterheben. Das Ganze ein wenig stehen lassen. Dann eine Pfanne mit
einem Esslöffel Rapsöl erhitzen und ein Viertel der Reibekuchenmasse hineingeben. Mehrmals wenden: Die mit der Zeit verklebte Masse dabei ruhig noch mal zerstören, mischen und wieder zusammen
drücken. Die Temperatur so regulieren, dass der Reibekuchen nicht anbrennt, aber auch Farbe bekommt. Nach etwa einer viertel Stunde einen Esslöffel Butter dazugeben. Den Reibekuchen in der Pfanne
schwenken, noch einmal wenden, mit ein wenig schwarzem Pfeffer bestreuen und bald servieren.
Geschmacklich harmonieren dazu Apfelmus oder Apfelkraut. Wer will, kann aber auch Ketchup dazu servieren oder den knusprigen Reibekuchen einfach pur essen. Guten Appetit!
Anhaltende Erschöpfung kann Anzeichen für Leberschäden sein
Leberschäden werden von Patienten oft unterschätzt. „Die Leber tut nicht weh, wenn sie geschädigt ist. Der Schmerz der Leber ist die Müdigkeit“, sagte Prof. Dr. Christian Strassburg, Universitätsklinikum Bonn, beim Pharmacon, einem internationalen Fortbildungskongress der Bundesapothekerkammer. „Betroffene schieben die anhaltende Erschöpfung oft auf ihren Beruf und lassen sich viel zu spät vom Arzt untersuchen.“ Anzeichen einer Leberschädigung können neben der Erschöpfung auch eine Gelbfärbung der Haut und Augen sein. Schwillt der Bauch bei einem Leberschaden durch Wassereinlagerungen an, wird das oft als gewöhnliche Gewichtszunahme oder „Bierbauch“ verkannt.
Einer der wichtigsten Risikofaktoren für Leberschäden ist ein übermäßiger Alkoholkonsum. Strassburg plädierte für einen bewussteren Umgang mit Alkohol, generelle Verbote lehnte er aber ab. „Die Leber und Alkohol vertragen sich gut, wenn man nur in Maßen trinkt und die Leber keinen Vorschaden hat“, sagte der Internist. „Trinkt man aber zu viel, steigert Alkohol das Risiko für Leberkrebs ähnlich wie Rauchen das für Lungenkrebs.“ Die tolerierte Menge liegt für Frauen bei einen Viertelliter Bier oder einen Achtelliter Wein pro Tag. Männer vertragen etwas das Doppelte, ohne einen Leberschaden zu riskieren. Werden über einen längeren Zeitraum mehr als 60 Gramm Alkohol pro Tag getrunken, das entspricht etwa einer Flasche Wein oder 1,5 Litern Bier, bildet sich oft eine Fettleber. Bei weiter fortgesetztem Alkoholkonsum kann die Leber ihre Funktionen nicht mehr erfüllen und das Risiko für Krebserkrankungen steigt.
Strassburg: „Es gibt keine „Happy-Pills“ für den Herrenabend: Medikamente oder Nahrungsergänzungsmittel, die die
Alkoholverträglichkeit verbessern oder den Alkoholschäden vorbeugen, gibt es nicht.“ Wer seine Leber schonen will, sollte auf Alkohol komplett verzichten oder nur noch geringe Mengen
trinken. Ohne die Belastung durch Alkohol regeneriert sich die Leber von selbst. Zwei Tassen Kaffee pro Tag wirken schützend auf die Leber, können eine übermäßigen Alkoholkonsum aber nicht
ausgleichen. Rotwein ist für die Leber nicht gesünder als andere alkoholische Getränke. Strassburg: „Wenn sich durch den Alkohol eine Lebererkrankung entwickelt hat, nutzt es nichts, dass
andere Inhaltsstoffe des Rotweins das Risiko für Herzerkrankungen senken.“
Quelle: Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände
Was ist "es" denn?
Der Unterschied zwischen den Geschlechtern wird nicht nur körperlich festgestellt. Die deutsche Sprache hält allerdings
keine begriffliche Unterscheidung für das körperliche und soziale Geschlecht parat.
Die Frauenforschung behalf sich daher bereits vor Jahrzehnten mit der englischen Sprache. In dieser wird zwischen
„sex“, das sich auf das physische Geschlecht bezieht, und „gender“, das soziale und kulturelle Eigenschaften meint, unterschieden.
Dabei zeigten Arbeiten aus der sogenannten Genderforschung, dass die Unterscheidung zwischen „sex“ und „gender“ nicht
immer sinnvoll ist. Denn auch die Wahrnehmung von Körpern wird durch gesellschaftliche Prozesse beeinflusst.
So analysierte 1992 Thomas Laquer* die „Inszenierung der Geschlechter“, indem er sagt: „Sowohl in der Welt, die das
leibliche Geschlecht als ein einziges versteht, als auch in der, die von zwei Geschlechtern ausgeht, ist Geschlecht eine Sache der Umstände, erklärbar wird es erst im Kontext der
Auseinandersetzung über Geschlechtsrollen (gender) und Macht.“
Spätestens direkt nach der Geburt wird ein Mensch einem Geschlecht zugeordnet. Nicht selten erfahren Eltern heute
während der Schwangerschaft, ob sie einen Sohn oder eine Tochter erwarten.
Während die Kategorien des Genders komplex und soziokulturell abhängig sind, sind ebenso die natürlichen Unterschiede
des Geschlechts keineswegs einfach zu greifen.
Mindestens fünf verschiedene Kriterien dienen einer naturwissenschaftlichen Betrachtung, um körperlich ein Geschlecht
zu bestimmen**:
1. Das Chromosomengeschlecht bestimmt sich nach der Geninformation im Erbgut.
2. Durch die Geninformationen der Geschlechtshormone unterscheiden sich die Keimdrüsen zu Eierstöcken oder
Hoden.
3. Das morphologische Geschlecht, also die inneren und äußeren Geschlechtsorgane, sowie der geschlechtstypische
Körperbau werden insbesondere durch Hormone gebildet.
4. Das Hormongeschlecht definiert sich durch die unterschiedlichen Konzentrationen der Geschlechtshormone.
5. Es gibt geschlechtstypische Besonderheiten im Gehirn, die die Ausschüttung von Sexualhormonen steuern.
Anhand dieser fünf Kriterien wird deutlich, dass neben den Gender-(Aus-)Wirkungen der Geschlechter insbesondere das morphologische Geschlecht in der alltäglichen Unterscheidung hervortritt. Eine streng biologische Geschlechtsdefinition wäre auch wohl zu vage, für ein zweigeschlechtliches System und Denken, die unsere Kultur dominieren.
Stefanie Schadt
Quellen:
* Thomas Laquer (1992): „Auf den Leib geschrieben. Die Inszenierung der
Geschlechter von der Antike bis Freud“
** Ursula Streckeisen (1991): „Statusübergänge im weiblichen Lebenslauf: Über Beruf, Familie und Macht in der
Ehe“
Diabetes
Dr. Martin Raschke ist Oberarzt des Reha-Zentrums Mölln. Klinik Föhrenkamp. printzip-Mitarbeiter Timo Schadt sprach mit dem
61-jährigen Diabetologen über die Behandlung von Diabetes.
Es gibt immer mehr Diabetiker. Woran liegt das?
Das ist sicher unserem Wohlstand geschuldet. Reichliches Nahrungsangebot bei reduzierter körperlicher Aktivität führt zu Übergewicht und das wiederum zum Typ 2 Diabetes.
Was sind Alarmzeichen für diese Erkrankung?
Typische Alarmzeichen sind starkes Durstgefühl, Mattigkeit, Müdigkeit, Gewichtsverlust. Aber meistens gibt es gar keine Alarmzeichen.
Ist Diabetes eine Erbkrankheit?
Erbkrankheit ist nicht ganz richtig. Die Veranlagung zu Diabetes wird vererbt. Es muss als Hauptfaktor das Übergewicht hinzukommen. Vielleicht sind es auch noch andere Umweltfaktoren, aber die
Vererbung alleine führt ganz selten zu Diabetes.
Landläufig geht man davon aus, Diabetiker dürfen keinen Zucker zu sich nehmen. Stimmt das?
Das stimmt heute so nicht mehr. In Deutschland hat es lange gedauert, bis man sich dazu durchgerungen hat. Aber seit etwa 1995 ist auch in offiziellen Empfehlungen das Zuckerverbot
gefallen.
Es gibt Vorurteile in der Bevölkerung gegenüber Diabetikern. Wie lassen die sich entkräften oder ist an ihnen etwas
dran?
Was mir spontan einfällt, ist, dass die Diabetiker schuld an ihrem Diabetes seien, wegen des Übergewichts. Dass sie sich nicht an die Ernährungsregeln halten. Also, sich insgesamt nicht an das
halten, was sie tun sollten.
Da ist sicherlich was dran. Wir sind inzwischen aber so weit, dass mehr als die Hälfte der Menschen übergewichtig ist in unserem Land. Das betrifft also nicht die Minderheit, sondern die
Mehrheit. Die Lösung dieses Problems hat ja nun leider noch keiner.
Darf man Diabetes als Behinderung bezeichnen?
Im Grunde nicht. Beim Versorgungsamt kann eine Behinderung beantragt und auch zugesprochen werden, wenn das tägliche Leben durch die Erkrankung und die notwendige Therapie, zum Beispiel die
Notwendigkeit Blutzucker zu messen sowie Insulin zu spritzen, deutlich eingeschränkt werden. Dann kann eine Behinderung anerkannt werden. Das betrifft in erster Linie Typ 1 Diabetiker. Wenn keine
zusätzlichen Krankheiten bestehen, dann werden Typ 2 Diabetiker nicht die ominösen „50 Prozent“ erreichen, um eine Behinderung zu erlangen.
Was unterscheidet Typ 1 vom Typ 2?
Der Unterschied liegt eigentlich in der Entstehung dieser Erkrankung. Beim Typ 1 Diabetes werden die Insulin bildenden Zellen in der Bauchspeichdrüse zerstört. Der wesentliche Punkt beim Typ 2
Diabetes ist, dass das weiterhin gebildete Insulin an den Körperzellen nicht gut wirkt.
Ist Diabetes heilbar?
Heute, nein.
Wie kommt das?
Zum Typ 1, der von der Entstehung her ganz anders als der Typ 2 ist: Die Zerstörung der Insulin bildenden Zellen kann man nicht rückgängig machen und bis heute auch nicht aufhalten, wenn man das
frühzeitig entdecken könnte.
Beim Typ 2 wäre eine „Heilung“ möglich, also eine Normalisierung des Blutzuckers, wenn die Menschen ihr Gewicht deutlich reduzieren und sich mehr körperlich betätigen würden. Die geerbte
Veranlagung bleibt aber bestehen.
…was in der Praxis aber seine Tücken hat.
Richtig.
Wie wird Diabetes gegenwärtig behandelt?
Der Typ 1 muss mit Insulin behandelt werden, weil das ja fehlt und ohne Insulin ein Leben nicht möglich ist.
Beim Typ 2 steht an erster Stelle eine gesunde Ernährung, dazu kommen sehr häufig Medikamente in Form von Tabletten oder schließlich auch eine Insulinbehandlung.
Sie setzten in der Reha-Klinik Föhrenkamp auf eine Mischung aus gesunder Ernährung und Bewegung. Gelingt es
Patienten dies in den Alltag mitzunehmen?
Dem einen mehr, dem anderen weniger. Das im Alltag umzusetzen, ist schon schwierig.
Was hat sich an der Behandlung von Diabetes in den letzten Jahren verändert?
Die grundlegenden Dinge haben sich nicht sehr verändert.
Neue Insulinsorten bieten manche Vorteile. Für den Typ 1 gibt es als ausgefeilteste Therapie Insulinpumpen. Die gibt es eigentlich auch schon über 25 Jahre Das ist aber weiter verfeinert
worden.
Zudem gibt es die Möglichkeit, mit sogenannten Sensoren den Blutzuckerspiegel kontinuierlich zu messen. Dies ist für die große Anzahl der Diabetiker leider nicht verfügbar.
Beim Typ 2- gibt es einige neue Tablettenarten, deren endgültiger Wert nach wenigen Behandlungsjahren sicherlich noch nicht
ganz abzuschätzen ist.
Viele grundlegende Dinge haben sich in den letzten Jahren eigentlich nicht geändert, aber wichtige Schritte die es für den Patienten, angenehmer machen. Seien es bessere Insulinnadeln oder
bessere Blutzuckermessgeräte, die das tägliche Leben erleichtern und auch die Therapie verbessern.
Aber in der Ernährungsberatung haben sich für Diabetiker doch Veränderungen ergeben?
Ja, vielleicht so seit zehn, fünfzehn Jahren hat sich das sehr liberalisiert. Die Erkenntnis, dass eine gesunde ausgewogene Ernährung wie für alle Menschen auch für Diabetiker geeignet ist. Es
gibt nur ganz wenige Einschränkungen, was zum Beispiel mit Zucker gesüßte Getränke angeht, die sollte man vermeiden. Außer bei Unterzuckerung.
Wie verhält es sich mit den Folgeerkrankungen von Diabetes?
Das ist ein weites Feld. Ich meine, man sollte den Menschen auch hier bei uns in der Klinik keine Angst einjagen und ihnen sagen: ‚Wenn du dich nicht kümmerst, wirst du diese und jene
Folgeerkrankungen bekommen‘.
Sicherlich ist bekannt, dass bei Menschen die den Diabetes schlecht behandeln - und dann muss man auch sagen, die sich selber schlecht behandeln - das Risiko größer ist Folgeerkrankungen zu
bekommen, als bei Menschen, wo die Behandlung gut läuft, die damit anders umgehen. Über Jahre – das betone ich eigentlich immer. Das sind keine Dinge die in Monaten entstehen. Wir versuchen, die
Patienten eher positiv zu motivieren, sich um den Diabetes zu kümmern, um diese Erkrankungen zu vermeiden.
Die Folgeerkrankungen sind aber kein Mythos?
Wichtig sind besonders die Erkrankungen des Gefäßsystems unter anderem der Augen und der Nieren. Das sind aber Erkrankungen, die sich in der Regel erst nach vielen Jahren Diabetes
einstellen.
Was genau ist die Aufgabe ihrer Klinik im Hinblick auf Diabetes?
Wir versuchen, den Menschen zu vermitteln, wie sie im Alltag Dinge besser umsetzten können, was Ernährung und körperliche Aktivität angeht. Wir sind uns allerdings darüber bewusst, dass das im
Klinikalltag sehr viel einfacher ist, als im Berufsalltag. Diese Vermittlung ist aber eigentlich das wesentliche Ziel der Rehabilitation.
Und Sie gehen davon aus, dass die Menschen das dann tatsächlich in ihren Alltag mitnehmen können?
(lacht)Wie heißt es so schön: Die Hoffnung stirbt zuletzt!

...kein Ei dem anderen
Skandalös ist, wenn Verbraucher gutgläubig Bio-Eier kaufen, dabei tatsächlich aber hinters Licht geführt werden.
Eier haben nicht erst seither einen schlechten Ruf, immer wieder ist von Salmonellen, Dioxinen und eben falschen Deklarationen die Rede. Trotzdem werden in Deutschland jährlich etwa 11
Milliarden Eier produziert. Ein Großteil wird auch hierzulande konsumiert. Dabei enthalten Hühnereier fast alle Vitamine, außer Vitamin C. Ein durchschnittlich großes Hühnerei kann bis zu
35 % des Tagesbedarfs an Vitamin D und 38 % des Bedarfs an Vitamin B12 decken.
Die Ernährung des Huhns ist für den Nährwert des Eies ausschlaggebend. Hühner, die neben Samen und Körnern zudem
frische Pflanzen, Insekten, Würmer und Schnecken fressen, produzieren Eier mit einem weit höheren Nährwert. Eier haben zwei Drittel mehr Vitamin A, zweimal mehr Omega-3-Fettsäuren,
dreimal mehr Vitamin E, vier- bis sechsmal mehr Vitamin D, siebenmal mehr Beta-Carotin, und ein Drittel weniger Cholesterin sowie weniger gesättigte Fettsäuren.
Auch wenn das einst so beliebte Frühstücksei an Beliebtheit verliert, schleichen sich Eier auf verschiedenen Wegen über diverse Lebensmittel in unsere
Nahrung ein. Eischnee und Eigelb findet sich in Kuchen, Nudeln aber auch Mayonnaise, Speiseeis und Desserts. Bei letzteren Produkten wird mit roher Ware gearbeitet. Die Beachtung
besonderer Hygiene ist daher dabei Grundvoraussetzung. Wer auf Nummer sicher gehen möchte, der Lebensmittelindustrie nicht traut und vor allem an wirklich frische Eier herankommt, kann
vieles des Vertrauens wegen selbst machen. Aber Vorsicht: Beim Öffnen der Eier können Bakterien von der Schalenoberfläche in die Eimasse gelangen. Um Lebensmittelvergiftungen zu
vermeiden, reicht es, ein paar Dinge zu beachten:
Das zu verarbeitende Ei kann für den Bruchteil einer Sekunde in kochendes Wasser getaucht von eventuellen
Bakterienbelegen auf der Schale wirkungsvoll befreit werden. Beim Umgang mit Eiern sollten sich besonders häufig die Hände gewaschen werden. Nicht gegarte Speisen, in denen frische Eier
verwendet wurden, sollten dann, wenn keine konservierenden Maßnahmen ergriffen wurden, am Tag der Herstellung verzehrt werden.
Die „Tierische-Lebensmittel-Hygieneverordnung“ schreibt unter anderem vor, dass Hühnereier innerhalb von 21 Tagen
nach dem Legen an den Verbraucher abgegeben werden müssen. Für Mayo und Desserts sollten unbedingt ganz frische Eier genommen werden. Ein Stempel auf dem Ei trifft nicht nur diesbezüglich
Aussagen. Dem Erzeugercode kann die Haltungsform des Huhns, das Land, aus dem das Ei stammt sowie die Erzeugerbetriebs- und Stallnummer entnommen werden. Dank des Erzeugercodes lässt sich
in Deutschland anhand der führenden Ziffer die Haltungsform feststellen:
0 = Bio-Eier: Freilandhaltung mit Futter aus ökologischem Anbau.
1 = Freilandhaltung
2 = Bodenhaltung
3 = Käfighaltung bzw. Kleingruppenhaltung in Legebatterien.
Weitere Angaben zum Code sind für jedes Ei individuell auf folgender Website zu entschlüsseln:
www.was-steht-auf-dem-ei.de Hier gibt es ebenfalls eine praktische und kostenlose App, mit ihr kann schon im Supermarkt nach
dem Rechten geschaut werden.
Während Hühnereier an Beliebtheit verlieren, sind die als Delikatesse geltenden Wachtel-eier im Kommen. Wachteln
gehören auch zu den Hühnervögeln, sind aber deren kleinste Vertreter. Ein Wachtelei ist dem entsprechend mit 10 bis 12 Gramm wesentlich kleiner als das fünf bis sechsmal so schwere
Hühnerei, enthält aber 30 % mehr Eigelb. Zudem ist es insgesamt reichhaltiger gegenüber dem Hühnerei mit fünfmal mehr Phosphor, siebenmal mehr Eisen, sechsmal mehr Vitamin B1, fünfzehnmal
mehr Vitamin B12 und der gleichen Menge an Kupfer und Zink.
Zubereiten lässt es sich genauso, wenn auch die Koch- und Garzeit aufgrund der Größe deutlich geringer ausfällt.
Wachteleier gelten als cholesterinfrei. Sie tragen zur Bildung von Betaendorphinen bei, körpereigenen Endorphinen, die stark euphorisierend dem Gemütszustand zuträglich sind. Sie helfen
Noradrenalin zu bilden, einen Neurotransmitter, der das Herz-Kreislauf-System anregt, und unterstützen die Kommunikation zwischen den Gehirnzellen durch Bildung von ACTH, einem
nebennierenstimulierendem Hormon. Wachteleier stärken das Immunsystem durch ihre gesundheitsfördernden Inhaltsstoffe. Sie wirken sich dadurch günstig bei Allergien, bei Asthma,
Heuschnupfen und Dermatitis aus.
Da Wachteln teils sehr grausam in engen Behältnissen gehalten werden, gilt auch hier, Quellen des Vertrauens auftun
und im Zweifel kontrollieren. Timo Schadt
Mundgeruch
Es ist eine besonders unangenehme Erfahrung, wenn sich beispielsweise der Partner oder ein Arbeitskollege angewidert
abwendet, nachdem er stinkendem Atem ausgesetzt wurde. Nicht immer sind übermäßiger Alkoholkonsum oder der
Verzehr von Zwiebelgewächsen ursächlich verantwortlich zu machen. Roher Knoblauch führt unweigerlich zu Mundgeruch. Auch Kaffee, Alkohol und Rauchen sind dafür Quellen. Kaffee übersäuert den
Mundraum, Alkohol trocknet die Schleimhäute aus.
Im Gemisch aus 78 % Stickstoff, 17 % Sauerstoff und 4 % Kohlendioxid sowie Wasserdampf enthält die Atemluft auch etwa 1
% weitere Gase, darunter die, welche dem Gegenüber ekelig erscheinen mögen.
Im Mund wimmelt es von Millionen an Mikro-ben, die ständig damit beschäftigt sind, Speisereste und abgestorbene Zellen
zu zersetzen. Dabei entstehen schwefelhaltige Gase. Dieser winzige Promilleanteil der Atemluft ist zwar unangenehm, aber in der Regel unbedenklich. Etwa 6 % der Menschen atmen dauerhaft und
gut 25 % zumindest zu bestimmten Tageszeiten Müffelndes aus. Bei gut 90 % der Betroffenen ist zunächst einmal eine mangelnde Mund- bzw. Zahnhygiene dafür verantwortlich zu machen. Doch nicht
immer sind es faule Zähne. Meistens sind es Essensreste, die in oder zwischen den Zähnen hängen oder sich in Zahnfleischtaschen abgelagert haben. Diese lassen sich mit regelmäßig verwendeter
Zahnseide, parallel zum Einsatz der Zahnbürste aus den Zahnzwischenräumen entfernen. Hinsichtlich der Gründlichkeit können elektrische Zahnbürsten beim Zähneputzen nachweislich zu besseren
Resultaten führen. Regelmäßige Zahnarztbesuche und entsprechende Behandlungen können unterstützend wirken, wo Zahnseide und Zahnbürste nicht hinkommen.
Bis zu 80 % der schwefelproduzierenden Bakterien besiedeln jedoch die Zunge, insbesondere den rauen hinteren Teil. Es
sollte daher selbstverständlich sein, auch diese zu reinigen. In früherer Zeit zog man sich die Zunge mit einem Lederriemen ab, heute sind im Handel spezielle Werkzeuge zu kaufen, doch auch
eine weiche Zahnbürste mit ein wenig Wasser tut ihren Dienst.
Mit handelsüblichen Mundspülungen kann akut entzündetes Zahnfleisch behandelt werden. Alternativ hilft Gurgeln mit
Teebaumöl, welches zu den ätherischen Ölen zählt und stark antibakteriell wirkt. Vom dauerhaften Einsatz raten Experten allerdings ab. Da nicht zwischen guten und schlechten Bakterien
unterschieden wird, kann die Mundflora durch solche Mundspülungen Schaden nehmen. Sinnvoller als Chemisches aus der Drogerie und Scharfes wie Teebaumöl erscheint eine „sanfte“ Spülung mit
Salzwasser oder auch Meersalz, die sich problemlos selbst herstellen lässt. Außerdem schwemmt im Normalfall Speichel Bakterien und Speisereste einfach fort und lässt diese gar nicht erst auf
der Zunge ansiedeln. Verminderter Speichelfluss, zum Beispiel als Nebenwirkung von Medikamenten oder im Rahmen einer Erkältung, kann Zungenbeläge begünstigen. Schon das Kauen von Kaugummi
kann hier wahre Wunder bewirken. Die Speichelbildung wird um bis zu 300 % angeregt. Auch wer ausreichend trinkt, hat mehr Speichel und verhindert nebenbei die Anlagerung von Speiseresten und
die Ansiedlung von Bakterien. Eine Verbesserung des Mundklimas können zahlreiche Kräuter und Gewürze mit sich bringen. Für den individuellen Geschmack, aber auch für die Ursache des
Mundgeruchs gibt es das passende Kraut. Bei akuter Entzündung im Mundraum hilft eine Gewürznelke. Sie wirkt neutralisierend und beim entzündeten Zahnfleisch platziert schmerzlindernd.
Gekauter Kardamom, Fenchel- und Anissamen helfen bei schlechtem Atem, ebenso zerkaute Wacholderbeeren und frische Petersilie. Ferner können Ingwerscheiben und Zitronensaft helfen, indem sie
den Speichelfluss anregen. Ebenfalls hilfreich gegen Mundgeruch und bei Rachenentzündungen wirken Salbei- und Kamillentee. Schwarzer Tee hemmt das Wachstum von Bakterien im Mund. Regelmäßiger
Verzehr von Naturjoghurt soll für deutlich weniger Zahnplaque, Zahnfleischtaschen und Schwefelwasserstoff im Mundraum sorgen.
Der morgendliche schlechte Mundgeruch kann übrigens in Speichelmangel seine Ursachen haben. Nachts wird nämlich
deutlich weniger davon produziert. Insbesondere bei nächtlicher Mundatmung trocknet der Mund aus. Ein „gutes“ Frühstück bringt da wieder Fluss in den Mundraum und vertreibt mit reichlich
neuer Speichelproduktion schlechten Atem.
Mundgeruch kann allerdings auch Indikator für teils gravierende gesundheitliche Beein-
trächtigungen sein. Ein eiterartiger Geruch des Atems kann Hinweis auf ein Lungenleiden sein. Aber auch zerklüftete,
chronisch entzündete Mandeln können für solche Eindrücke verantwortlich gemacht werden.
Für ein Magenleiden spricht ein säuerlicher Atem. Eine zerkaute geröstete Kaffeebohne kann diesen sauren Geruch
neutralisieren. Meerrettichwurzel wirkt hier ähnlich. Die Atemluft von Diabetikern kann obstartig riechen. Bei Lebererkrankungen kann in manchen Fällen ein erdartiger oder nach Ammoniak
riechender Atem auftreten. Bei Nierenerkrankungen kann eine ammoniakartige Duftnote wahrgenommen werden. In diesen Fällen gelangen flüchtige Substanzen in die Blutbahn und werden über die
Lunge abgeatmet. Bei Magenschleimhautentzündungen oder Auswölbungen der Speiseröhre können ebenfalls unangenehm riechende Gase über den Mund entweichen.
Nur zu 5 bis 8 % sind vorübergehende Mandel-, Rachen-, Nasennebenhöhlen- und gar Lungenentzündungen vom Arzt als
Ursache für übel riechenden Atem festzustellen. Zahnfleischentzündungen, Entzündungen im Mund- und Rachenraum sorgen häufiger für einen unangenehmen Atem. Zahn- oder Hausärzte helfen dann in
der Regel schnell.
Ein Problem ist: Unangenehmes oder gar Gesundheitsbedenkliches selbst im eigenen Atem festzustellen fällt schwer, daher
sollte im Zweifel der Partner dazu befragt oder das Thema beim Hausarzt angesprochen werden. Wie dargelegt, ist manches Leiden zu riechen. Sicherer aber ist ein Labortest, als sich auf die
Nase zu verlassen.
Timo Schadt
Was Kinder brauchen
Am 8. Dezember 2012 startete im Fuldaer Bonifatiushaus eine neue Reihe, die eine Schnittmenge zwischen Eltern- und
beruflicher Weiterbildung anbietet. „Was Kleinkinder brauchen“ so der Titel, der Eltern, Interessierte und Leute aus betreffenden Berufen ansprechen soll. Einstieg bildete die Beschäftigung mit
drei verschiedenen Blickwinkeln auf die Möglichkeiten sowie Fähigkeiten der kindlichen Entwicklung.
Der Bildungsberater Ulrich Dreismickenbecker aus Speyer, Organisator und Moderator des Seminartages, stellte bei der
Begrüßung fest, dass der Veranstaltungstitel somit auch „Was Eltern brauchen“ hätte heißen können.
Was eine gelungene Entwicklung von Kindern unterstützt, wurde von drei Referenten aufgearbeitet. Insbesondere
wissenschaftliche Einsichten aus der Hirnforschung standen dabei im Fokus.
Der erste Referent, PD Dr. Jörg Bock vom Otto von Guericke Institut, Universität Magdeburg, vermittelte
Forschungserkenntnisse aus der Neurobiologie. Zentral war dabei, dass Gehirn als Netzwerk zu begreifen und somit dessen Verbindungen der einzelnen Teile.
Synapsen, also die Kontaktstellen zwischen Nervenzellen, bilden sich in den ersten Lebensjahren rasant aus. Vereinfacht
ausgedrückt, bedeutet das, wenn ein Kind positive kindliche Erfahrungen sammelt beziehungsweise Lernprozesse durchläuft, die auf Neugier, Freude und Spaß basieren, wirkt sich das auf die
Synapsenverstärkung aus. Im Umkehrschluss heißt das - so die Vermutung, da Experimente nur an Tieren und nicht am Menschen möglich sind - kommt es zu negativen Einwirkungen, wie dauerhaften
Stress, hat zumindest das Tierexperiment ergeben, dass damit einer fehlerhaften Entwicklung der Weg geebnet wird. Das bedeutet nun aber nicht, dass Kinder ab dem zweiten Lebensjahr unbedingt
Englisch und vorzugweise vor Eintritt in die Grundschule Chinesisch lernen sollten. Vielmehr sind positive Lernerfahrungen zu unterstützen, da sich derart angeeignetes Wissen
verfestigt.
Der zweite Referent, der Entwicklungspsychologe Prof. Ludger van Gisteren, verdeutlichte die Verquickung zwischen positiven
Beziehungserfahrungen als Bestandteil von Lernprozessen und der kindlichen Entwicklung. In seinem Vortrag „Psychoanalyse und Hirnforschung“ wurde er nicht müde, darauf hinzuweisen, dass
Kleinkinder 24 Stunden am Tag lernen, also auch im Schlaf.
Die Spiegelungen, die ein Kind erfährt, sind somit fundamental. Zur Verdeutlichung brachte van Gisteren das Beispiel eines
freudig erregten Kindes, das mit dieser Emotion auf sein depressives Elternteil stößt. Hier wird die Emotion, also die Freude nicht erwidert oder zumindest nicht authentisch gespiegelt, so dass
das Kind lernt, dass dieses Gefühl nicht angebracht sei.
Der dritte Referent, Herbert Renz-Polster, zog augenscheinlich die Teilnehmenden am Ende eines informativen und langen
Seminartages in seinen Bann. Fast 90 Minuten hielt er einen freien Vortrag, der sehr anschaulich, auch unterhaltsam und vor allem erhellend seine evolutionsbiologische Perspektive für die
kindliche Entwicklung herausarbeitete.
Der Kinderarzt und Autor veranschaulichte beispielsweise am leidigen Streitthema, ob und wie lange das Kind im elterlichen
Bett schlafen darf, dass vieles, was abhängig von Kultur und Zeitgeist unterschiedlich beantwortet wird, aus Sicht der menschlichen Evolution gar nicht diskutiert zu werden bräuchte. So entführte
er die Anwesenden ein paar Jahrtausende zurück, um zu verdeutlichen, dass Fragen der Gegenwart nicht gegenwärtig beantwortet gehören, sondern der Blick in die Vergangenheit ausreichend
erklärt.
Renz-Polster erzählte von der Dunkelheit, in der sich unsere Vorfahren allenfalls durch den Schein eines Feuers ab abends
befanden. Er sprach von all den Geräuschen, die die Menschen umgaben, und die wir vielleicht „vom Campen an der Adria“ selbst kennen. Doch diese Geräusche und auch „aufblinkende Äuglein im
Dickicht“ erfuhren die nomadenhaften Menschen nicht in der Umzäunung eines Zeltplatzes, sondern ganz und gar ungeschützt. Folglich war selbstverständlich, dass die Kinder nicht irgendwo allein
und ungesichert schliefen, sondern im unmittelbaren Schutz der Eltern, denn sonst hätten die kleinen Nachkommen nicht lange überlebt.
Derlei Erfahrungen, die das menschliche Dasein lange Zeit prägten und erst mit Einsetzen der Industrialisierung abebbten,
sitzen als Information tief im Menschen, somit auch im Kind. So sollte es nicht wundern, dass Babys und Kinder bei den Eltern schlafen wollen, denn sie haben nicht das Bewusstsein, dass ihnen in
der hübschen 4-Zimmer-Wohung mitten in Fulda im Dunklen nichts Lebensbedrohliches passieren kann.
Ebenfalls einleuchtend erläuterte Renz-Polster die sogenannte Trotzphase, die etwa ab dem zweiten Lebensjahr eintritt. Die
machen kleine Menschen nicht durch, um sich als Tyrannen zu üben, sondern um Selbsttätigkeit und -wirksamkeit zu erlernen. Unsere Ur-Mütter stillten nämlich ihre Kinder durchschnittlich um den
30. Monat herum ab, da sich alsbald der nächste Nachwuchs ankündigte. Mit dem neuen Säugling war der Mutter nicht mehr möglich, dass Kleinkind überall mitzutragen. Quengelt ein Kind, obwohl es
laufen kann, weil es auf den Arm will, ist dies auch als Überbleibsel einer lebenserhaltenden Maßnahme unserer Vorfahren zu verstehen.
Ein Kind der Frühzeit musste, wenn die Mutter beispielsweise beim Essensammeln war, beim Rest der Gruppe, wie den
Geschwistern bleiben. Um sich im Gruppengefüge positionieren zu können, sammelt das Kind selbsttätige Erfahrungen und greift dafür auch zu den berüchtigten Wutanfällen. Damit sichert es sich
sowohl das Überleben in der Kindergruppe als auch ausreichend Aufmerksamkeit der Mutter, die mit einem kleineren Geschwisterchen beschäftigt ist. Das Verständnis der Trotzphase als evolutionäres
Überlebensprogramm kann Eltern der Gegenwart somit helfen, gelassener mit dem Nachwuchs umzugehen.
Stefanie Schadt







